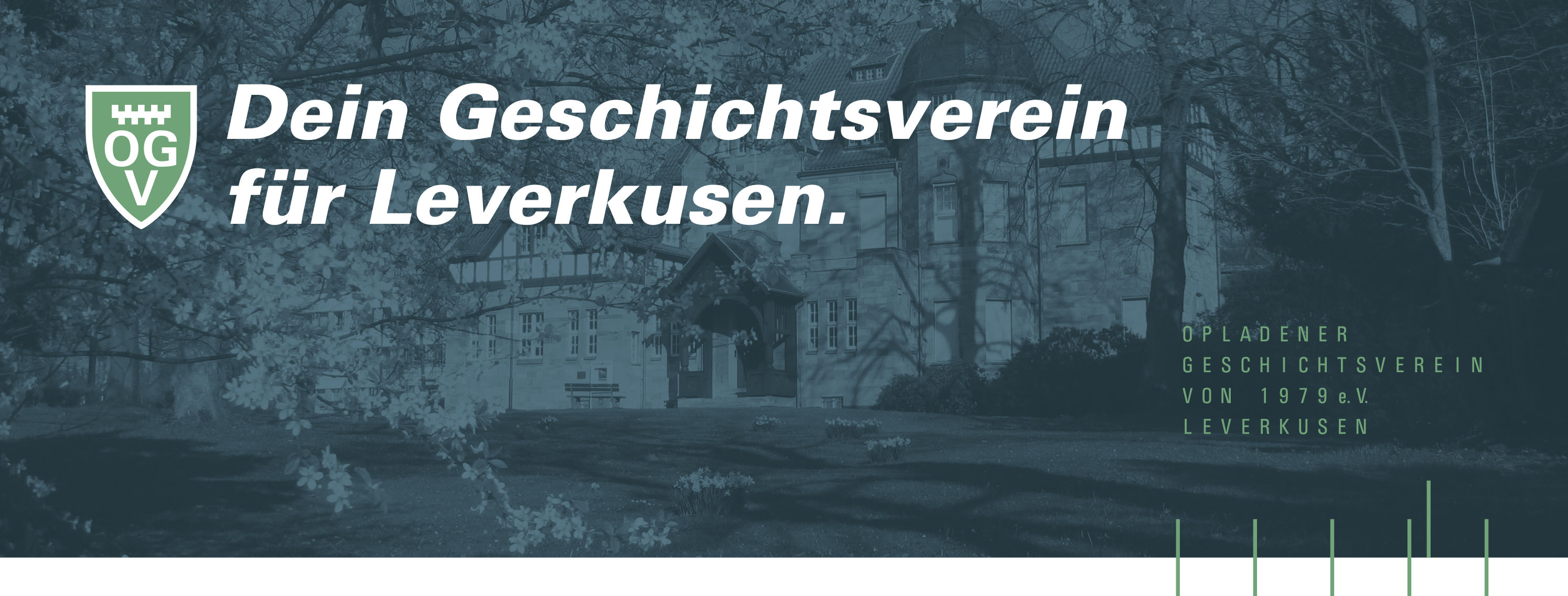Europa braucht Geschichte – heute mehr denn je!
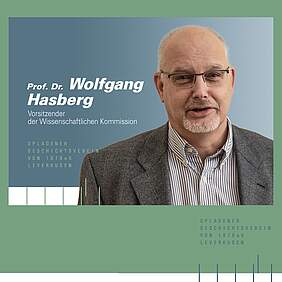
„Europa ist wach, hellwach.“, verkündete die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, jüngst in einem Interview mit der Wochenzeitung „Die Zeit“. Damit signalisierte sie, dass die Europäische Union gerüstet sei, künftig ihre Belange auch ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten von Amerika oder gar gegen die Zollpolitik eines Donald Trump oder die ideologischen Anwürfe eines JD Vance durchzusetzen. Die Anstrengungen, die dazu auf militärischem wie wirtschaftlichem, aber eben auch im Feld der politischen Kooperation in Europa notwendig sein werden, sind enorm. Ob U. v. d. Leyen Recht behält, wird erst die Zukunft erweisen. Gelingen können die zu unternehmenden Anstrengungen allerdings nur, wenn Europa sich als eine Einheit versteht. Vor Jahren beklagte Wolfgang Schmale, dass Europa an einem Mythendefizit laboriere, und meinte damit, dass es nicht eine einzige Gründungsgeschichte Europas gäbe, sondern allzu viele, als dass es eine einheitliche Geschichte Europas geben könne. Das ist kein Mangel, sondern eine Chance. Dazu muss allerdings die Geschichte als eine solche erzählt werden, die überall in Europa unterschiedlich ist, sich aber im Kern trifft. Dieser Kern ist die Diskursgemeinschaft, nicht die Geschichte selbst. Deshalb gilt es - heute mehr denn je - einen Erinnerungsdiskurs in Gang zu setzen, der die Unterschiede nicht nivelliert, sondern immer wieder neu zur Sprache bringt. Nicht, um den Konflikt zu schüren, sondern sich der unterschiedlichen Herkunft angesichts einer gemeinsamen Zukunft inne zu werden. Es bedarf einer diskursiven Erinnerung in Europa, die über die Unterschiede die Gemeinsamkeiten zutage fördert.
An diesem Diskurs wirkt der OGV seit Langem mit. Nach dem erfolgreichen Europaprojekt "StadtRäume/UrbanSpaces" geht er mit seinen Partnern, den alten und neuen, nun in eine zweite Runde. Die Anträge sind gestellt. Und sofern sie Zustimmung finden, wird vom Herbst an "StadtRäume/UrbanSpaces 2.0" ins Rennen gehen. In ein Rennen, das vor allem das Ziel vor Augen hat, Europa als Erinnerungsgemeinschaft zu begreifen, die eine Zukunft hat. Auf einer solchen Erinnerungsbasis, die Unterschiede nicht verschweigt, aber die gemeinsame Zukunft fest im Blick hat, können die Reformen gründen, die notwendig sind, um Europa in einer veränderten globalen Ordnung zu positionieren und die Veränderungen in Gang zu setzen, die U. v. d. Leyen im Blick hat.
Die europäische Geschichte, die es neu zu bedenken gilt, um politischen Maßnahmen eine Basis zu geben, gründet allerdings in den Wurzeln der lokalen Geschichte, der Heimat. Allerdings trägt auch sie europäisches Gepräge. Das hat nicht nur "StadtRäume/UrbanSpaces" gezeigt, indem es die Gemeinsamkeiten der Aufbruchzeit zwischen den großen Weltkriegen des 20. Jahrhunderts thematisiert hat. Das haben ebenso die Bemühungen des OGV um die Stadtjubiläen 2020 und 2025 deutlich gemacht, die nur im Kontext der europäischen Entwicklung der 1920er und 1970er Jahre verständlich werden.
In diesem Sinne liegen die Bemühungen der unterschiedlichen Gruppen des OGV ganz im Zuge der Zeit, die es notwendig erscheinen lässt, neu über Europa nachzudenken und dem europäischen Integrationsgedanken die Geschichte zu geben, die diskursiv genug ist, der Vielfalt Europas gerecht zu werden. Eine solche Geschichte braucht Europa – heute mehr denn je.
Prof. Dr. Wolfgang Hasberg
Universität zu Köln
Vorsitzender der Wissenschaftlichen Kommission des OGV