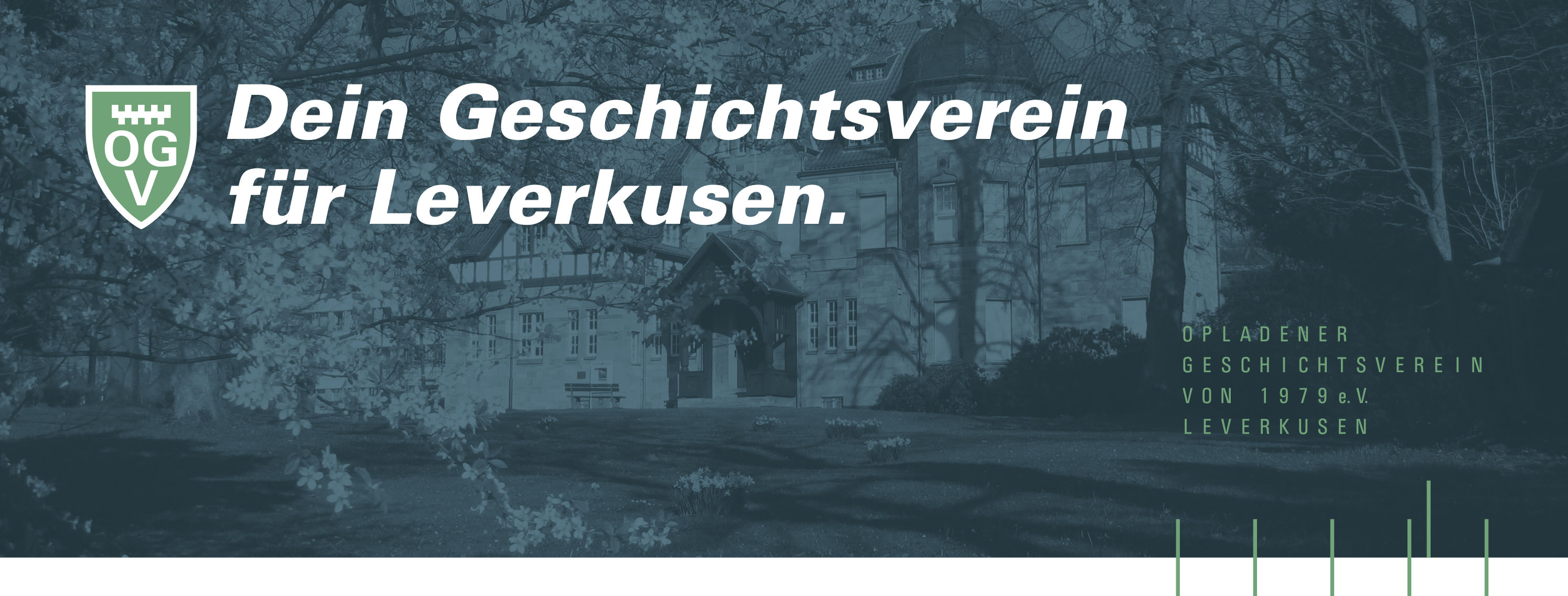StadtRäume 2.0
in Kooperation mit dem Jülicher Geschichtsverein 1923 e.V.
Kreative Stadtgeschichte im europäischen Netzwerk

Mit StadtRäume 2.0 eröffnet der Opladener Geschichtsverein von 1979 e.V. Leverkusen gemeinsam mit dem Jülicher Geschichtsverein 1923 e.V. ein neues Kapitel europäischer Geschichts- und Bildungsarbeit. Das transnationale Projekt knüpft an die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre an und erweitert das Konsortium deutlich: Zu den bisherigen Partnerstädten Bracknell (UK), Racibórz (PL), Oulu (FI), Ljubljana (SI), Schwedt/Oder (DE) und Villeneuve d’Ascq (FR) kommen nun Delphi (GR), Nikopol (UA), Gabrovo (BG) und Battipaglia (IT) hinzu.
Zentral bleibt der Blick auf Stadtentwicklung und Demokratiegeschichte – insbesondere im Spiegel der Zwischenkriegszeit (1918–1939), einer Phase tiefgreifender politischer und gesellschaftlicher Veränderungen in Europa. Gleichzeitig richtet StadtRäume 2.0 den Fokus auf neue Formen der Vermittlung: Wir erweitern unseren digitalen Filmbaukasten, entwickeln künstlerische Formate, eine Weiterbildungs-App und beziehen verstärkt Jugendliche in die Projektarbeit ein. Zudem sind neue Publikationen und Veranstaltungsformate geplant.
Für 2026 bereiten wir drei internationale Workshops vor (vorbehaltlich der Förderzusage):
-
Berlin & Schwedt/Oder (18.-22. März 2026) – Präsentation und Weiterentwicklung unserer Ansätze zur Demokratie- und Stadtgeschichte in europäischer Perspektive
-
Leverkusen & Jülich (7.-10. Mai 2026, Europatag) – Austausch, Jugendbeteiligung und Weiterarbeit an Film-, App- und Publikationsprojekten
-
Oulu (3.-7. September 2026, Kulturhauptstadt Europas) – Studienreise und Workshop zur Vorstellung der Projektergebnisse und Perspektiven von StadtRäume 2.0
StadtRäume 2.0 verbindet europäische Stadtgeschichte, Demokratieentwicklung, Kunst und digitale Innovation – und schafft neue kreative Wege, Vergangenheit und Gegenwart miteinander ins Gespräch zu bringen.
18. bis 22. März 2026: Workshop in Berlin und Schwedt/Oder


Unter dem Motto „Demokratieentwicklung und Erinnerungsorte der Zwischenkriegszeit“ tauchen wir in Berlin und Schwedt/Oder in die historischen Stadträume der Weimarer Republik ein. Am 19. März 2026 starten wir in der Landeszentrale für politische Bildung Berlin, stellen das StadtRäume-Projekt und pädagogische Tools vor und besuchen den Friedhof der Märzgefallenen. Am nächsten Tag beleuchten wir in Schwedt/Oder die Perspektive einer kleineren Stadt zwischen Provinz und Modernisierung. So verbinden wir historische Forschung, politische Bildung und bürgerschaftlichen Dialog.
7. bis 10. Mai 2026: Workshop in Jülich und Leverkusen


Im Rahmen der Europawoche 2026 vertiefen wir im Projekt „UrbanSpaces 2.0: StadtRäume Europa“ die europäische Zusammenarbeit. Vom 7. bis 10. Mai 2026 laden der Opladener und der Jülicher Geschichtsverein sowie europäische Partner zu Workshops ein, die Demokratiegeschichte und Erinnerungskultur in den Fokus rücken. Bürgerinnen und Bürger aus Leverkusen, Jülich und den neuen Partnerstädten kommen zusammen, um historische Erfahrungen mit aktuellen europäischen Herausforderungen zu verknüpfen.
30. August bis 6. September 2026: Studienreise nach und Workshop in Oulu


3. bis 6. September 2026: Projekt-Workshop in Oulu
In Oulu, der Kulturhauptstadt Europas 2026, soll vom 6. bis .5. September 2026 der letzte Workshop des Jahres stattfinden – und zugleich präsentieren wir hier erste Zwischenergebnisse, denn das Projekt wird danach noch weitergehen. Wir kombinieren den Workshop mit einer Studienreise, um die Kulturhauptstadt im europäischen Kontext zu erkunden und die Ergebnisse von StadtRäume 2.0 sowie des ersten StadtRäume-Projekts vorzustellen. So tragen wir unsere Arbeit in einen inspirierenden europäischen Rahmen und laden auch Bürgerinnen und Bürger vor Ort ein, daran teilzuhaben.
30. August bis 6. September 2026: Studienreise in die europäische Kulturhauptstadt 2026 Oulu
in Kooperation mit der Deutsch-Finnischen Gesellschaft Leverkusen e.V.
Planung einer 1-wöchigen Studienreise (Flug/Bus) ab Düsseldorf nach Oulu mit einem eintägigen Zwischenaufenthalt in Helsinki.
Ablauf und Programm werden zurzeit erarbeitet.
Interessenten können – unverbindlich ! – mit Kontaktdaten unter geschaeftsstelle@ogv-leverkusen.de in eine vorläufige Interessentenliste aufgenommen werden.
Mit der Veröffentlichung des Programmangebotes werden die Interessenten benachrichtigt.
Allgemeine Hinweise:
Alle Workshops sind offen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Partnerstädten sowie für interessierte Bürgerinnen und Bürger vor Ort. In jeder Stadt werden auch lokale Erinnerungsorte besucht, um die historische Dimension greifbar zu machen. So tragen wir StadtRäume 2.0 mitten in die Städte und fördern den Austausch auf europäischer Ebene.
Anmeldung für unsere Workshops
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Workshops und bieten Ihnen hier die Möglichkeit der Online-Anmeldung. Alle Details zu den Workshops, enthaltene Leistungen und mögliche Abfahrtsorte finden Sie weiter oben. Bitte teilen Sie uns unbedingt mit, ob Sie ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer wünschen. Melden Sie in diesem Fall Ihre(n) Reisepartner(in) mit an (unter "weitere Mitteilungen") oder verwenden Sie ein neues Formular. Die weitere Abwicklung erfolgt in unserem Auftrag durch die Firma DerPart Reisebüro Leverkusen-Opladen.