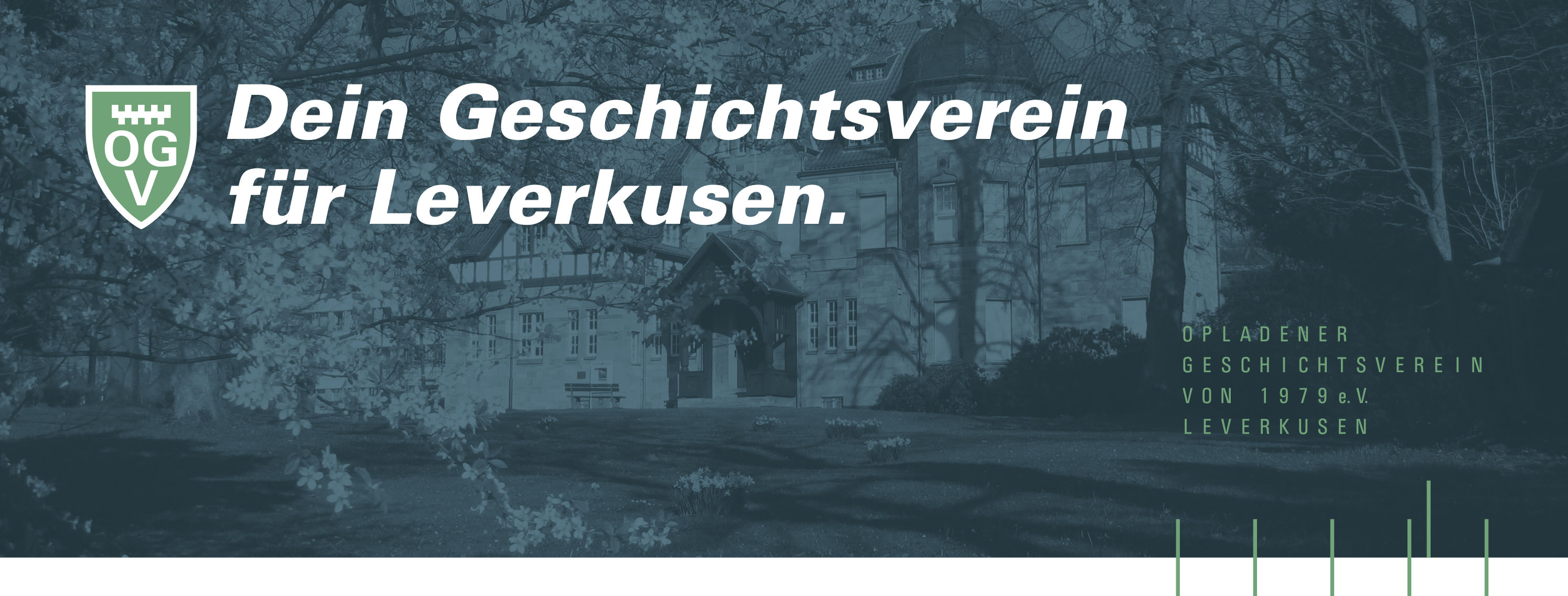OGV will Stadträume-Projekt mit neuem Schwerpunkt fortsetzen. Am Workshop mit Partnerstädten nehmen erstmals auch Ukrainer teil.

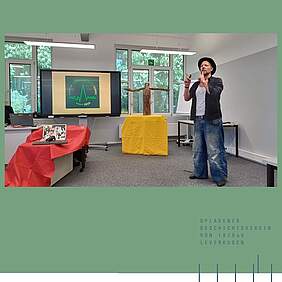
Der Opladener Geschichtsverein von 1979 e.V. Leverkusen (OGV) und seine Kooperationspartner wollen an das Stadträume-Projekt zur Zwischenkriegszeit anknüpfen. Dafür haben sich Mitglieder des OGV und des befreundeten Jülicher Geschichtsvereins am Wochenende mit Mitstreitinneren und Mitstreitern aus den Leverkusener Partnerstädten Schwedt/Oder, Bracknell (GB), Ratibor (PL), Oulu (FIN) und Villeneuve d'Ascq (F) zu einem Workshop getroffen. Erstmalig dabei waren auch zwei Vertreterinnen aus Nikopol, der neuen ukrainischen Partnerstadt Leverkusens. Das Land NRW hat den Workshop mit einem „Europa-Scheck" gefördert.
Ausstellung zur Zwischenkriegszeit war Ende 2023 eröffnet worden
In dem durch die Europäische Union geförderten Stadträume-Projekt hatte der OGV seit 2020 über mehrere Jahre mit unterschiedlichen Institutionen aus den europäischen Partnerstädten zusammengearbeitet. Die von der Arbeitsgruppe mit Unterstützung des Leverkusener Stadtarchivs zusammengestellte Ausstellung „Leverkusen: StadtRäume zwischen den Kriegen" hatte der OGV 2023/2024 präsentiert und mit einem umfassenden Programm begleitet. Entstanden ist zudem ein interaktiver Filmbaukasten zur Geschichte der Zwischenkriegszeit (1918-1939). Zwei Sammelbände, einer mit Aufsätzen zur Leverkusener Stadtgeschichte und einer mit internationalen Beiträgen, sollen noch veröffentlicht werden.
Gefährdungen der Demokratie als möglicher Schwerpunkt eines neuen Projekts
Jetzt haben die Projektpartner im Rahmen des Workshops in Leverkusen diskutiert, wie an dieses Projekt angeknüpft werden könnte. In den Räumlichkeiten der Volkshochschule Leverkusen sprachen sie über Formate und etwaige inhaltliche Schwerpunkte. Eine Möglichkeit wäre, sich in einem kommenden Projekt intensiver mit den Gefährdungen der Demokratie in der Zwischenkriegszeit zu beschäftigen.
Zwischenkriegszeit: Auf Demokratie-Welle folgt Entdemokratisierung
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs war es zunächst zu einer Demokratisierungswelle in weiten Teilen Europas gekommen. Auch in Deutschland hatte sich nach der November-Revolution erstmals dauerhaft eine Republik etabliert und in den 1920er Jahren zunächst auch stabilisiert. Bekanntermaßen scheiterte die Weimarer Republik aber, als 1933 die Nationalsozialisten an die Macht gelangten. Auch in Ländern wie Polen, Spanien oder Österreich folgten in der Zwischenkriegszeit autoritäre Regime auf demokratische Systeme.
Sogar in etablierten Demokratien wie Frankreich oder England kokettierten manche Kreise des Bürgertums mit der autoritären Versuchung. Sie nahmen, maßgeblich durch Propaganda vermittelt, im faschistischen Italien und im nationalsozialistischen Deutschland eine Dynamik wahr, die die liberalen Systeme seit der Weltwirtschaftskrise vermeintlich verloren zu haben schienen. Gerade in der Arbeiterschaft wiederum wirkte angesichts der um das Jahr 1929/30 einsetzenden Dauerkrise des Kapitalismus das sowjetische Modell immer anziehender.
Entscheidung über Förderung in den kommenden Monaten
In mehreren westeuropäischen Ländern setzte sich erst in den Boomjahren nach dem Zweiten Weltkrieg die liberale Demokratie, in der Bundesrepublik nun unter dem Banner der Sozialen Marktwirtschaft, nachhaltig durch. Angesichts der heutigen Bewährungsprobe parlamentarisch-demokratischer Systeme lohnt die Beschäftigung mit der Geschichte der Zwischenkriegszeit sehr, sind sie beim OGV überzeugt. Ob die Europäische Union eine Fortsetzung des Projekts mit neuen Schwerpunkten fördern wird, entscheidet sich in den kommenden Monaten.