Rezension / Büchertipp: Gefährliche Zeiten. Ein Leben im 20. Jahrhundert.
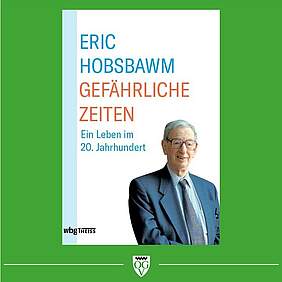
Eric Hobsbawm: Gefährliche Zeiten. Ein Leben im 20. Jahrhundert. Aus dem Englischen von Udo Rennert, ND Darmstadt 2019.
499 S., ISBN 978-3-8062-3894-5 (in Verbindung mit Eric Hobsbawm: Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte im 20. Jahrhundert), 78,- €.
Eines der wirkmächtigsten Bücher Eric Hobsbawms (1917-2012) trägt den Titel „Invention of Tradition“. Darin erläutert er, wie Traditionen nicht einfach Fortsetzungen von Gewesenem sind, sondern auch ganz bewusst ins Leben gerufen werden können. Das gilt sicher auch für Biographien und vor allem Autobiographien wie der vorliegenden, in der einer der bekanntesten Neuzeithistoriker des 20. Jahrhunderts sein Leben in Abrissen erzählt. Dessen aber ist der Autor sich vollauf bewusst: Nicht zuletzt macht er das mit einem Augenzwinkern im Epilog seines umfassenden Bandes deutlich, wenn er zugibt, Biographien hätten ein natürliches Ende, Autobiographien nicht. Damit macht er klar, dass auch seine Lebensbeschreibung eine Konstruktion ist, die der Verfasser zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, mit einer ganz bestimmten Sicht auf die zurückliegenden Zeiten schreibt.
Diese reflexive Attitüde durchzieht das ganze Buch, ohne dass sie dabei penetrant zutage treten würde. Mit seiner zwar selbstbewussten, aber stets die eigene Eitelkeit zugleich wieder süffisant konterkarierenden Haltung gelingt es E. Hobsbawm „ein Leben im 20. Jahrhundert“ aufzuzeigen, das einerseits selbstverständlich die Besonderheiten eines Intellektuellen getragen hat und andererseits ganz typische Züge eines Menschen, der nahezu das gesamte 20. Jahrhundert durchwandert hat.
Dabei ist Durchwandern durchaus auch im räumlichen Sinne ein angebrachter Begriff. So ist die eigenartige Schreibweise seines Nachnamens nur der Unachtsamkeit eines britischen Kolonialbeamten in Ägypten geschuldet, der aus dem U ein W und aus dem Neugeborenen einen Hobsbawm anstatt einen Hobsbaum machte, wie es dem Nachnamen seiner jüdischen Familie entsprochen hätte. Dabei war sein Vater ein britischer Staatsbürger, während seine Mutter einer österreichischen Familie angehörte. In den Kreis der mütterlichen Verwandtschaft zog es die junge Familie bereits 1921 auch wieder zurück, bevor der Vater 1929 frühzeitig und die Mutter nur zwei Jahre später verstarb, so dass der jugendliche Eric und seine jüngere Schwester als Waisen mit Onkel und Tante nach Berlin übersiedelten, wo der Patchwork-Familie kein Wohlstand, aber zumindest für die nächsten Jahre ein gesichertes Einkommen zur Verfügung stand. Das ermöglichte es dem zweisprachig aufgewachsenen Eric weiterhin ein Gymnasium zu besuchen, das er freilich nicht zum Abschluss bringen konnte, weil die Familie 1934 erneut umzog; dieses Mal nach England, wo ein weiterer Teil der Hobsbaums ansässig war.
Mit London schloss der Jugendliche, der sich mit seinem Cousin (später ein erfolgreicher Musikverleger) sogleich dem Jazz verschrieben hatte, ganz allmählich Freundschaft. Zwar kam ihm die Großstadt London zunächst als ein wenig heimatlicher Ort vor, gleichwohl ermöglichte sie ihm, weiterhin seinen literarischen Interessen nachzugehen und seinen Schulabschluss zu vollenden. Dieser brachte ihm ein Stipendium an der Cambridge University ein, in deren berühmten King‘s College er viele Jahre seines weiteren Lebens verbrachte. Unumwunden gibt er zu, dass die Universität in den 1930er Jahren nicht eben für ihre Exzellenz in der geisteswissenschaftlichen Forschung bekannt gewesen sei, sondern Wirtschaftswissenschaften und Biochemie die Fächer darstellten, die damals international reüssierten. Dafür aber bot die Universität mit ihren durchaus gemäßigten Anforderungen neben den Studien genügend Zeit, sich einer zweiten Leidenschaft hinzugeben, die den Neuzeithistoriker zeit seines Lebens umtrieb, nämlich der Politik.
Bereits in seinen Berliner Jahren hatte Eric sich als Halbwüchsiger dem Sozialismus zugewandt und trat nun der Kommunistischen Partei Englands bei. Er wird nicht müde, in seiner Autobiographie sein Bekenntnis zum Kommunismus immer wieder zu erneuern, indem er weite Teile der Darstellung dem Ausleben eben dieser Leidenschaft widmet. Aktivist war er durchaus, wenn freilich in dem Sinne eines Intellektuellen, der sich nicht an die Front von Demonstrationszügen oder Streiks stellt, sondern wortgewaltig oder zumindest inspirierend an die Spitze von geistigen Bewegungen. Dies beschreibt der Verfasser immer wieder, wenn auch für den mit der Entwicklung der britischen KP nicht Vertrauten nicht immer in der notwendig detaillierten Weise, wie es wünschenswert gewesen wäre. Dafür aber beleuchtet er gut nachvollziehbar, wie sich die ablehnende Haltung gegenüber dem Kommunismus erst nach 1945 wirklich ausbildete, während dieser in den 1930er und 1940er Jahren in Cambridge noch viele Anhänger besaß und noch kein wirkliches Hindernis für das berufliche Fortkommen in Behörden und Wissenschaft war.
Das änderte sich mit dem Kalten Krieg, während dem der Kommunismus zum verzerrten Feindbild wurde, nicht zuletzt durch die Gestalt, die er durch den ideologischen Führungsanspruch der KPdSU erhalten hatte, der weltweit beherrschend wurde. Deshalb war die Erschütterung so stark, als N. Chruschtschow auf dem XX. Parteitag der KPdSU 1956 die brutalen Verbrechen Stalins entdeckte, der bis dahin als unumstrittener und unhinterfragbarer Führer gegolten hatte. Diese Entdeckungen brachten die kommunistischen Parteien in allen Ländern in Misskredit. Nicht anders in England, wo der promovierte Historiker E. Hobsbawm, dessen kommunistische Haltung allgemein bekannt war, noch immer nicht die erhoffte Universitätsprofessur erhalten hatte. Er führt diesen Karriereknick – ohne es explizit zu benennen – auf seine politische Haltung zurück und empfindet das umso ärgerlicher, als er in der Retrospektive zugleich erkennt, dass der Zweite Weltkrieg ihm sechs Jahre seines Lebens gekostet habe. Während andere, vor allem die sprachgewandten Cambridge-Historiker, häufig in den Dechiffrierdienst des Militärs eingezogen wurden, musste der nicht minder polyglotte jüdische Brite, der bis dahin lange Jahre seines Lebens in Mitteleuropa verbracht hatte, in einer weitgehend unbeschäftigten Pioniereinheit Dienst tun, was ihn von Kampfhandlungen fernhielt, weil er während des Krieges zu keiner Zeit die Insel Großbritannien verließ. „Wenn ich meine persönliche Erfahrung im Zweiten Weltkrieg in wenigen Worten zusammenfassen soll,“ so schreibt er, „dann würde ich sagen, dass er mich um sechseinhalb Jahre meines Lebens gebracht hat“ (S. 183), und fügt an anderer Stelle hinzu: „Was die größte und entscheidendste Krise in der Geschichte der neuzeitlichen Welt betraf, war meine Anwesenheit völlig unerheblich.“ (S. 201) Daraus spricht einiges an Frustration, die nicht zuletzt darin begründet gelegen haben mag, dass sein wissenschaftliches Fortkommen während dieser Zeit brach lag, auch wenn er 1945 sein Stipendium in Cambridge wieder aufnehmen konnte.
Über seine beeindruckende Karriere als Wissenschaftler erfährt der Leser nicht allzu viel. Es sind eher Randnotizen, die Hobsbawm darüber zum Besten gibt, so dass die Bezüge nicht ganz greifbar, aber tastbar werden, in denen seine Karriere sich vollzogen hat. Neben den familiären Bezügen, bei denen freilich jederzeit die gebotene Distanz gewahrt wird, sind es vor allem die Verhältnisse in Cambridge, in dessen King‘s College er offenkundig für lange Jahre eine seiner vielen Heimaten gefunden hat, und vor allem die zahlreichen persönlichen Bekanntschaften, die sich auf dem Lebensweg punktuell als auch dauerhaft ergeben haben. Zumal der Autor offenkundig Freude daran empfindet, die auftretenden Personen sowohl in ihrer äußeren Gestalt als auch als inwendige Charaktere darzustellen, und zwar so, wie er sie wahrgenommen zu haben meint. So nehmen nicht nur sie, sondern auch der sich dabei immer wieder als subjektiver Beobachter entlarvende Autor menschliche Züge an.
Es ist beeindruckend, wie der Autobiograph immer wieder zwischen dem, was er in der Erinnerung meint erlebt zu haben und dem, was Historiker über die Zeit aussagen, zu changieren versucht. Hilfreich dabei sind ihm Tagebücher, die er während einiger Phasen seines Lebens geführt hat und in denen er manche Einträge gefunden hat, die er sich selber nicht mehr zu erklären vermag. Darin liegt eine der Stärken des lesenswerten Bandes, dass sein Autor keineswegs der Auffassung huldigt, als Zeitgenosse könne er verbindliche Auskunft darüber geben, was sich in den vergangenen Zeiten zugetragen hat. Es ist ihm durchaus bewusst, dass er aus einer Perspektive erzählt, die das Resultat seines persönlichen Miterlebens und seiner subjektiven Erfahrung sind. Dass das Buch eine „unpersönliche Autobiographie“ sei, wie ein Rezensent bemerkt zu haben meint, lässt sich schwer nachvollziehen, wenn man sich erst einmal auf das Buch und den Mann, der es geschrieben hat, eingelassen hat. Sicher aber ist es eine außergewöhnliche Autobiographie, wie sie einem außergewöhnlichen Wissenschaftler mit einem bemerkenswerten politischen Interesse entspricht, wie auch dem typisch britischen Understatement, dem sich der polyglotte Kosmopolit offenkundig letztlich nicht hat entziehen können.
Verwundert ist man weniger der Form halber, als wegen des Buchtitels. Auch wenn E. Hobsbawm das 20. Jahrhundert an anderer Stelle als ein „Zeitalter der Extreme“ beschrieben hat – von persönlichen Gefahren, die ihm auf seinem langen Lebensweg begegnet wären, ist in seiner Autobiographie kaum bis gar nicht die Rede. Vielleicht hat er auch ihn in der Nachbetrachtung als extrem, aber wohl kaum aus gefährlich empfunden. Interesting times lautet der Titel der englischen Originalausgabe, der deutlich besser zu passen scheint. Zwar sind alle Zeiten interessant, vor allem, wenn man sie miterlebt hat, aber Hobsbawm vermag es, seine Zeit auch demjenigen interessant werden zu lassen, der sie nicht miterlebt hat. Deshalb sei das Buch all denjenigen zur Lektüre empfohlen, die sich für Andere in anderen Zeiten interessieren.

